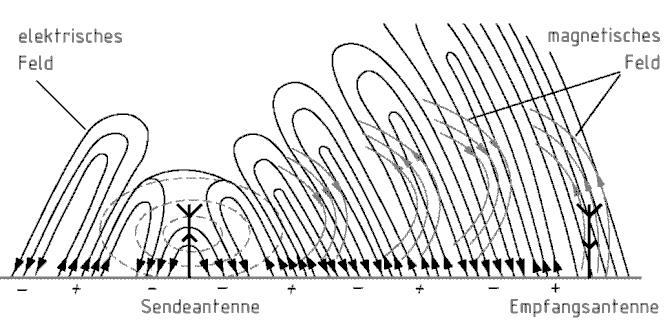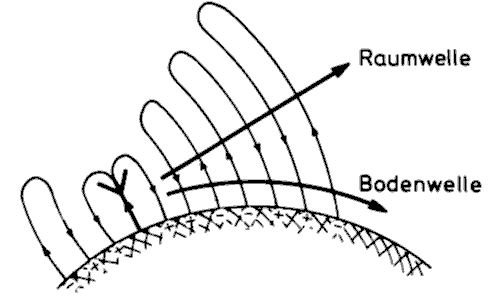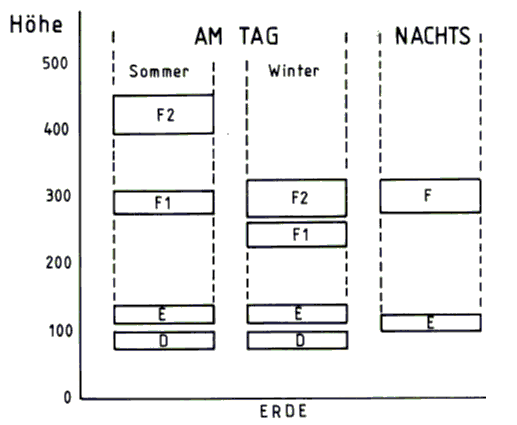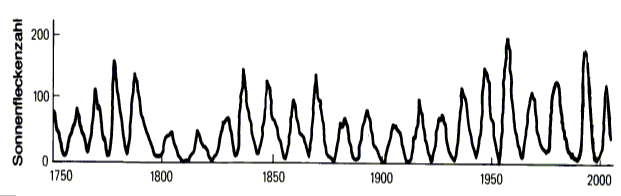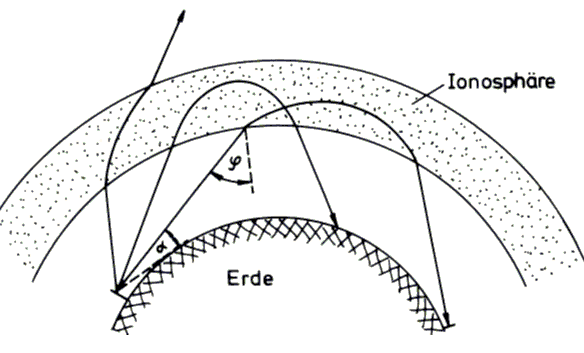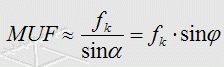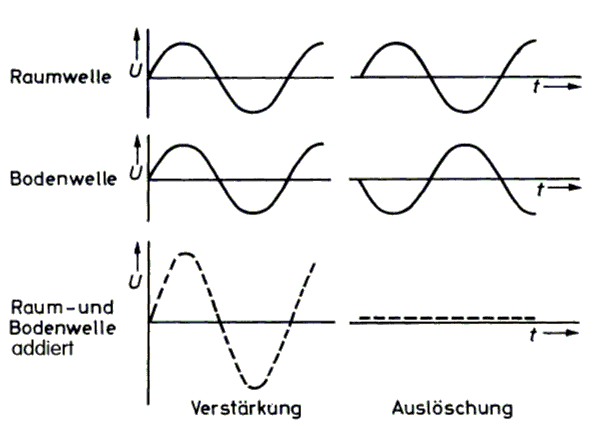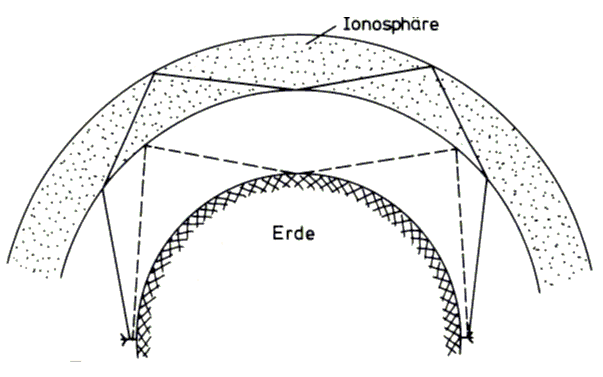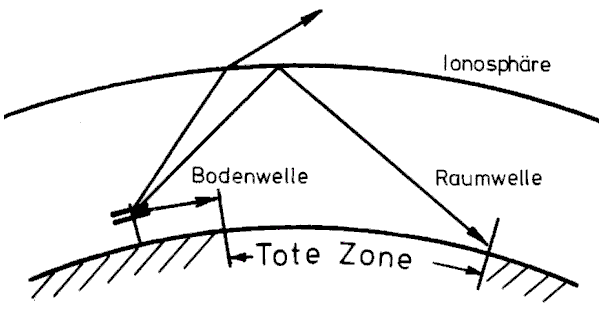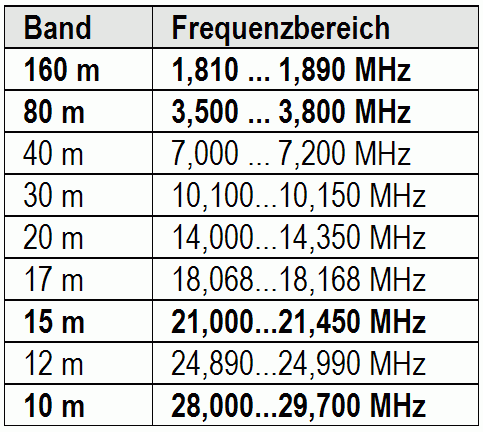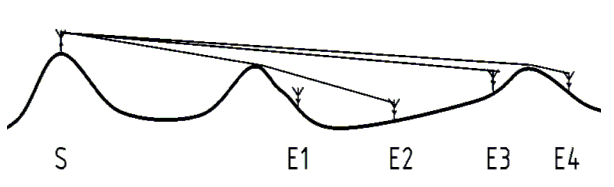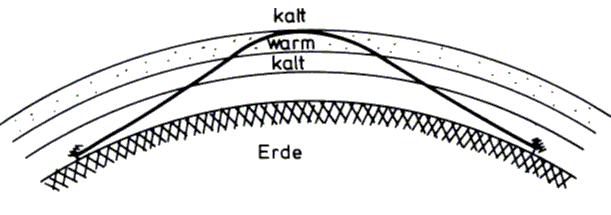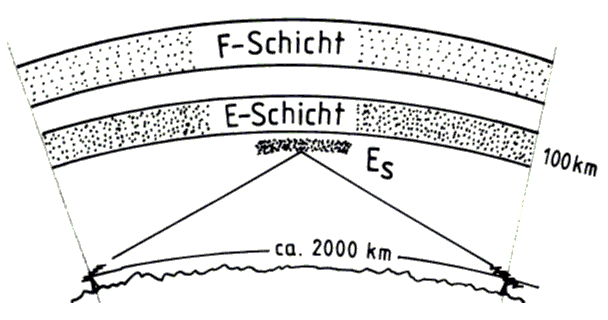|
DARC e.V. Offline-Version Klasse E für Ausbilder |
Achtung! Dies ist die Offline-Version nur für Ausbilder des Amateurfunk-Lehrgangs für die Klasse E von Eckart K. W. Moltrecht, DJ4UF, einschließlich des Lehrgangs für Betriebstechnik und Vorschriften. Links ins Internet funktionieren natürlich nicht.
Übersicht
Funkamateure senden im Kurzwellenbereich und im Ultrakurzwellenbereich. Die Wellenausbreitung auf Kurzwelle unterscheidet sich grundsätzlich von der auf Ultrakurzwelle. Während im Kurzwellenbereich die Ionosphäre in 100 km bis 400 km eine Reflexion der Wellen ermöglicht und dadurch weltweite Funkverbindungen zustande kommen, breiten sich die Wellen im UKW-Bereich (VHF/UHF) vorwiegend wie Licht aus und ermöglichen Reichweiten, die häufig nur der optischen Sicht entsprechen. Allerdings gibt es auf Ultrakurzwelle recht interessante Überreichweiten, die den Weitfunkverkehr sehr interessant machen. Der Vorteil der Kurzwellen ist also die große Reichweite. Der Nachteil ist aber die dafür notwendigen großen Abmessungen der Kurzwellenantennen. Im UKW-Bereich kann man wegen der geringen Baugröße Gewinn bringende Antennen verwenden. Viele Funkamateure finden den Weitfunkverkehr auf UKW interessanter, weil dort sehr weite Verbindungen nicht alltäglich sind und deshalb diese bei besonderen Ausbreitungsbedingungen auftretenden Überreichweiten zu regelrechten Glücksmomenten gezählt werden können. Kurzwellenausbreitung
Gehen wir einmal davon aus, dass eine Sendeantenne die Energie in Form elektro-magnetischer Schwingungen (Wellen) gleichmäßig in alle Richtungen in den Raum hinaus abstrahlt. Ein Teil dieser Wellen bewegt sich entlang der Erdoberfläche fort. Man nennt diesen Teil Bodenwellen. Alle übrigen Wellen nennt man Raumwellen (Bild 9-1), die an der Ionosphäre reflektiert werden. Die Bodenwellen werden mit zunehmender Frequenz stark gedämpft. Hat die Bodenwelle im 80-m-Band noch etwa 100 km Reichweite, beträgt sie im 40-m-Band noch 50 km, im 20-m-Band 25 km. Die Bodenwelle hat für den Amateurfunk nur geringe Bedeutung. Sie wird im Lang- und Mittelwellenbereich ausgenutzt. Da die Bodenwelle bei Langwelle der Erdkrümmung folgt, wird sie zum Beispiel für den Zeitzeichensender DCF77 (77 kHz) ausgenutzt, so dass diese Funkwellen überall in Europa hörbar sind. Mehr zur Wellenausbreitung über die Wellenausbreitung der Raumwellen folgt in den nächsten Abschnitten. Prüfungsfrage:
Sie haben die Frage gut beantwortet, wenn Sie in der linken Spalte nur einmal das Wort "Richtig" sehen und keinmal "Falsch".
Ionosphäre
Für den Amateurfunk im Kurzwellenbereich sind die Raumwellen von besonderer Bedeutung. In etwa 100 km bis 500 km Höhe von der Erdoberfläche befinden sich Schichten, die durch die Sonneneinstrahlung ionisiert und damit elektrisch leitfähig gemacht werden (Bild 9-2). An dieser Ionosphäre oder Heaviside-Schicht (so genannt nach ihrem Entdecker) werden die Raumwellen gebrochen und schließlich reflektiert. Das Reflexionsvermögen ist von der Stärke der Ionisation (Winter, Sommer, Tag, Nacht) und von der Frequenz der elektromagnetischen Wellen abhängig. Deshalb gibt es für die einzelnen Amateurfunkbänder ganz unterschiedliche Reichweiten, die von der Tageszeit, der Jahreszeit und auch dem elfjährigen Zyklus der Sonnenaktivität (Sonnenflecken) abhängig sind. Prüfungsfrage:
Prüfungsfrage:
Prüfungsfrage:
Prüfungsfrage:
Sonnenflecken
Die mit geschwärzten Gläsern und dem Teleskop beobachtbaren Sonnenflecken stellen Gebiete enormer Eruptionen elektrisch geladener Gase dar, die von starken Magnetfeldern begleitet werden. Diese Gase sind im Vergleich zur übrigen Sonnenfläche merklich kühler und wirken dadurch dunkler. Die Sonnenflecken sind einem im Mittel elfjährigen Zyklus unterworfen (Bild 9-3), wie man aus Aufzeichnungen am Schweizer Bundesobservatorium in Zürich feststellen kann. Um die Beobachtungen besser vergleichen zu können, hat man die Sonnenfleckenrelativzahl definiert und diese Zahl monatlich gemittelt und „geglättet“. Im Bild 9-3 ist der Verlauf der geglätteten Sonnenfleckenzahlen dargestellt, die bisher gemessen wurden. Aus diesem Diagramm geht hervor, dass die Sonnenfleckenzahl im Jahre 1959 ein Maximum von 200, 1969 von 100 und 1980 von 140 erreichte. Außerdem geht daraus hervor, dass ein solcher Zyklus etwa 11 Jahre dauert. Diese Sonnenflecken sowie die Stellung der Sonne zur Erde (Jahreszeit) bestimmen die Stärke der Ionisierung der Ionosphäre und damit die Ausbreitungsbedingungen. Prüfungsfrage:
Reichweite der Raumwellen
Die Reichweite der Raumwellen ist außerdem vom Auftreffwinkel auf die Ionosphäre abhängig. Je flacher die Welle auf die Ionosphäre auftrifft, desto leichter erfolgt die Reflexion (Bild 9-4). Von Ionosphärenmessstationen wird die so genannte kritische Frequenz fk gemessen. Das ist die höchste Frequenz, bei der die senkrecht in die Ionosphäre eintretende Raumwelle gerade noch reflektiert wird. Daraus ergibt sich die obere brauchbare Grenzfrequenz MUF (maximum usable frequency) durch das so genannte Sekansgesetz (Näherungsformel für α ≥ 40°). Alle Frequenzen oberhalb der MUF werden nur gebrochen und kommen nicht zur Erde zurück. Sie sind nicht mehr brauchbar (usable), auch nicht mit höherer Leistung. Übrigens ist die Frequenz kurz unterhalb der MUF für die Ausbreitung am günstigsten. Dort ist die Dämpfung am geringsten und der so genannte Skip (Sprungentfernung) am größten. Prüfungsfrage:
Prüfungsfrage:
D-Schicht Außer vom Reflexionsverhalten der Ionosphäre beziehungsweise der oberen Grenzfrequenz (MUF) ist die Reichweite der Kurzwellen von der sich zwischen der Erdoberfläche und der Ionosphäre tagsüber bildenden Dämpfungsschicht (D-Schicht) abhängig (Bild 9-2). Diese D-Schicht absorbiert (dämpft) die Frequenzen des Mittelwellenbereichs (160-m-Band) und des unteren Kurzwellenbereichs (80-m-Band). Die relativ geringen Tagesreichweiten auf diesen Bändern besonders in den Sommermonaten lassen sich hauptsächlich darauf zurückführen. Mit Sonnenuntergang verschwindet diese Dämpfungsschicht sehr schnell. Dann sind auch auf diesen Bändern große Reichweiten möglich. Manchmal allerdings wird diese D-Schicht so stark ionisiert, dass der gesamte Kurzwellenbereich davon betroffen ist. Für eine Stunde bis zu mehreren Stunden ist dann kaum ein Funkbetrieb über Reflexion an der Ionosphäre möglich. Dieser plötzliche Ausbreitungseinbruch wird „Mögel-Dellinger-Effekt“ genannt. Allerdings lässt sich mit extremer Leistungserhöhung die Dämpfung der D-Schicht ausgleichen, was bei Erreichen der MUF nicht möglich wäre. Wenn man die MUF überschreitet, ist keine Reflexion mehr vorhanden. Prüfungsfrage:
Prüfungsfrage:
Prüfungsfrage:
Prüfungsfrage:
Fading
In der Zone, in der gleichzeitig die Bodenwelle noch vorhanden ist und bereits die Raumwelle erscheint, gibt es Überlagerungen dieser Wellen. Es kann besonders bei AM-Sendungen (Mittelwellenrundfunk) zu Verstärkungen und Auslöschungen kommen (Bild 9-5), die wegen der ständigen Bewegung der Ionosphäre ständig abwechseln. Der Empfang ist gestört. Man nennt diese Erscheinung Fading (gesprochen: fähding). Eine andere Art von Fading („Flatterfading“) tritt gelegentlich auf, wenn es bei UKW gelegentlich zu Reflexionen an Flugzeugen kommt. Ein langsamer Feldstärkeschwund (kein Fading) kann bei Fernverbindungen durch Drehung der Polarisation auftreten, was man dadurch kompensieren kann, dass man eine vertikal und eine horizontal polarisierte Antenne entsprechend umschaltet. Prüfungsfrage:
F-Schicht und E-Schicht
Den Hauptteil der Ausbreitung über Reflexionen an ionisierenden Schichten trägt die F-Schicht. Durch die F2-Schicht insbesondere werden die enormen Reichweiten (interkontinental) der Kurzwellen möglich. Diese Schicht weist die größte Höhenausdehnung auf. Die Ionisierung erfolgt sehr träge und viel weniger abhängig von der Sonnenstellung als dies bei den tiefer liegenden Schichten der Fall ist. Mit Hilfe der F2-Schicht kann bei einem Sprung (Skip) eine Entfernung bis zirka 4000 km überbrückt werden. In der F-Schicht gibt es manchmal Doppelreflexionen (M-Reflexion). Es gibt auch Mehrfachreflexionen zwischen Ionosphäre und Erde (besonders Wasser), wodurch die größtmöglichen Reichweiten erzielt werden. Es kommt sogar vor, dass man eine Station auf dem direkten Weg und gleichzeitig auf dem indirekten Weg (langer Weg in entgegen gesetzter Richtung um den Erdball) hört, wodurch das Signal verhallt klingt. Nach Sonnenuntergang vermindert sich die Ionenkonzentration der F-Schicht allmählich. Sie erreicht kurz vor Sonnenaufgang ein Minimum. In den Tagesstunden kann sich die F-Schicht bei intensiver Bestrahlung in zwei Schichten aufspalten. Die niedriger liegende F1-Schicht dämpft dann die von der F2-Schicht reflektierte Strahlung. Dadurch kommt es zu geringeren Reichweiten (Kurzsprung-Entfernungen = short skip) in den Tagesstunden. Dann wird plötzlich Europafunkverkehr möglich, während in den Nachtstunden nur interkontinentaler Funkverkehr möglich ist. Prüfungsfrage:
Prüfungsfrage:
Tipp: Siehe auch Bild 9-2! In den Sommermonaten Juni, Juli und August bildet sich tagsüber eine weitere ionisierte Schicht aus, die E-Schicht. Diese E-Schicht befindet sich in nur 100 km Höhe und reflektiert Kurzwellen und gelegentlich auch Ultrakurzwellen. Dadurch kommt es auf den hochfrequenten Bändern 10 m, 6 m und gelegentlich auch auf 2 m (Sporadic-E) zu Kurzsprung-Entfernungen (Short Skip) mit Europa-Funkverkehrsmöglichkeiten mit sehr starken Signalen bei Entfernungen zwischen 750 und 2200 km. Die sporadische E-Schicht mit einer Grenzfrequenz über 100 MHz wirkt wie ein kleiner Spiegel, der oft nur ein Gebiet von 20 bis 100 km Durchmesser abdeckt. Man muss viel Geduld aufbringen und dann anrufen, wenn das Signal gerade sehr stark wird. Mehr dazu unter UKW-Ausbreitung E-Sporadic am Ende dieser Lektion! Prüfungsfrage:
Prüfungsfrage:
Prüfungsfrage:
Prüfungsfrage:
Tote Zone
Zwischen dem Abklingbereich der Bodenwelle und den Punkten, an denen die reflektierte Raumwelle wieder die Erdoberfläche erreicht, liegt eine empfangstote Zone, in der weder die Bodenwelle noch die Raumwelle empfangen werden kann. Die Ausdehnung der Toten Zone entspricht der Sprungdistanz (skip oder hop) minus der Reichweite der Bodenwelle und hängt von der Höhe beziehungsweise dem Ionisationsgrad der reflektierenden Schicht und der benutzten Sendefrequenz ab. Hierbei können immer wieder interessante Phänomene beobachtet werden, wenn beispielsweise die Bodenwelle nur 50 km weit reicht und der Skip 1000 km beträgt. Dann kann ich in Aachen eine Station aus Frankfurt nicht hören, aber eine Station aus Süditalien mit hervorragender Feldstärke. Eine Station aus der Schweiz könnte ich in diesem Fall auch nicht hören. Es könnte passieren, dass die Schweizer Station mit einer Dänischen Station gleichzeitig auf derselben Frequenz arbeitet ohne dass sich die Stationen gegenseitig stören. Prüfungsfrage:
Reichweite auf Kurzwelle Die Anfangs- und Endfrequenzen dieser Bänder sollten Sie wirklich auswendig können - nicht nur für die Prüfung!
Das 160-m-Band hat Mittelwellencharakter. Eine nahe der Erdoberfläche liegende D-Schicht dämpft die Raumwellen am Tage. Nach Sonnenuntergang verschwindet die D-Schicht und es findet eine Reflexion im unteren Bereich der F-Schicht statt. Dadurch werden dann Reichweiten von mehreren 1000 km möglich. Während der Tagesstunden können im 80-m-Band nur relativ geringe Reichweiten erzielt werden, da die D-Schicht stark dämpfend wirkt. Im Winter und zu Zeiten des Sonnenfleckenminimums sind die Tagesreichweiten größer. In diesen Zeiten aber bieten sich in den Nachtstunden besonders vor Sonnenaufgang ausgezeichnete DX-Möglichkeiten (DX = Verbindung über sehr weite Entfernungen). Die dabei auftretende „Tote Zone“ von etwa 1000 km Sprungentfernung (Skip) bewirkt, dass die sonst sehr starken Europastationen den Empfang der relativ schwachen DX-Stationen nicht oder nur wenig stören können. Vereinfacht gesagt ist aber das 80-m-Band das typische Band für den Funkverkehr innerhalb des eigenen Landes. Die Tages-D-Schicht bewirkt auch im 40-m-Band noch eine gewisse Dämpfung. Man erreicht aber auch tagsüber Entfernungen in der Größenordnung von 1000 Kilometern. Besonders zu Zeiten des Sonnenfleckenminimums bestehen oft ab den späten Nachmittagsstunden interkontinentale Verbindungsmöglichkeiten, die aber wegen störender Signale der Nahstationen nur selten genutzt werden können. Nachts - insbesondere während der Wintermonate - vergrößert sich der Skip, so dass Europa dann in der Toten Zone liegt. Dann sind störungsfreie Interkontinental-Verbindungen möglich, wenn der gesamte Ausbreitungspfad innerhalb der Dunkelzone liegt, da dort die absorbierende D-Schicht fehlt. Zusammenfassend wird das 40-m-Band als typisches Europaband bezeichnet. Ähnlich verhält sich das 30-m-Band: Europaband am Tage, in den Sommermonaten und in den sonnenfleckenarmen Zeiten. Aber interkontinentaler Funkverkehr ist in den anderen Zeiten möglich. Das 20-m-Band stellt das traditionelle DX-Band dar. Fast zu allen Zeiten (außer bei „Short Skip“ durch E-Schicht im Sommer) lässt sich dieses Band tags und nachts für den Funkverkehr mit anderen Kontinenten nutzen. Lediglich in den Zeiten des Sonnenfleckenminimums ist das Band nur tagsüber und in den Dämmerungsperioden „offen“. Nachts ist das Band dann „tot“. Die Ausbreitungsbedingungen im 15-m-Band und im 17-m-Band sind stark vom Sonnentätigkeitszyklus abhängig. Während des Sonnenfleckenmaximums sind diese Bänder fast durchgehend für den DX-Funkverkehr geöffnet. Dabei können wegen der geringen Dämpfung mit geringen Strahlungsleistungen sehr große Entfernungen überbrückt werden. Zu Zeiten des Sonnenfleckenminimums sind diese hochfrequenten Bänder bestenfalls in den Sommermonaten tagsüber und meist nur kurzzeitig brauchbar, in den Wintermonaten ganztägig tot. Gelegentlich können Reflexionen an der sporadischen E-Schicht auftreten. Es sind dann auch hier Short-Skip-Verbindungen über Entfernungen bis 2000 km möglich. Die beiden obersten Kurzwellenbänder 12-m- und 10-m-Band sind nur in Zeiten starker Sonnenaktivität für Verbindungen über Raumwellenreflexion brauchbar. Es bestehen dann während der Tagesstunden hervorragende DX-Möglichkeiten. Wegen der sehr geringen Dämpfung können selbst mit sehr kleinen Leistungen, zum Beispiel mit einem Watt, Weitverbindungen hergestellt werden. Die Abhängigkeit von der Sonnentätigkeit ist extrem. Zu den Zeiten des Sonnenflecken-minimums fallen diese Bänder für Fernverbindungen völlig aus. Lediglich durch Reflexionen an der sporadischen E-Schicht bestehen in den Sommermonaten gelegentlich Verbindungsmöglichkeiten über mittlere Entfernungen (Short Skip). Gray line DX: Besonders große Reichweiten auf den Kurzwellenbändern gibt es im Bereich der Dämmerungszone, also in dem schmalen Streifen auf der Erde zwischen Dunkelheit und Sonnenaufgang beziehungsweise zwischen Abenddämmerung und Dunkelheit der Nacht. Prüfungsfrage:
Prüfungsfrage:
Prüfungsfrage:
Prüfungsfrage:
UKW-Wellenausbreitung Die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen ist im VHF/UHF-Bereich grundsätzlich anders als im Kurzwellenbereich. Die Ausbreitung der Ultrakurzwellen ähnelt mit zunehmender Frequenz der des Lichtes. Man spricht auch von „quasi optischer“ Ausbreitung. Diese Wellen bereiten sich nahezu geradlinig aus und werden wie das Licht reflektiert, gebeugt und gebrochen. Durch Beugung an den Luftschichten in Bodennähe reichen die Wellen zirka 15% über den optischen Horizont hinaus. Eine Reflexion an der Ionosphäre findet, abgesehen von sehr seltenen Ausnahmen, nicht statt. Die unter normalen Bedingungen überbrückbaren Entfernungen sind deshalb nicht groß. Sie betragen je nach Frequenzbereich, Gelände und vor allem je nach Höhe der Antennen über Normalnull (NN) etwa 10 bis 150 km. Es kann vorkommen, dass es zu weiter entfernten Stationen besser geht als zu nah gelegenen Stationen. Dies ist immer dann der Fall, wenn unebenes Gelände zwischen den Stationen liegt. Man spricht von „Abschattungen“ wie bei Licht, wenn sich eine Empfangsstation direkt am Hang hinter einem Berg befindet (E1 im Bild 9-8).
Prüfungsfrage:
Prüfungsfrage:
Prüfungsfrage:
Prüfungsfrage:
Troposphärische Überreichweiten
Sehr interessant für die Funkamateure sind die so genannten Überreichweiten, von denen hier einige etwas genauer beschrieben werden sollen. In der Troposphäre (das ist die Schicht, in der das normale Wetter stattfindet) nimmt normalerweise die Temperatur bis ca. 10 km mit zunehmender Höhe gleichmäßig ab. Durch meteorologische Vorgänge kann jedoch die Temperaturänderung sprunghaft erfolgen. Dabei schieben sich wärmere Luftmassen zwischen oder über kältere Luftschichten, so dass sogar Temperaturumkehrungen (Inversionen) auftreten können (Bild 9-9). Da sich Ultrakurzwellen wie Licht verhalten, werden sie beim Übergang von einem dichteren (kalte Luft) zu einem dünneren Medium (warme Luft) gebrochen. Sie erfahren eine Krümmung zur Erdoberfläche hin, was zu einer enormen Vergrößerung der Reichweite führt. Solche Inversionen führen dazu, dass auf den Bändern 2 m, 70 cm und 23 cm Reichweiten bis 1000 km erreicht werden. Diese Inversionen wandern im Laufe des Tages. So kann es sein, dass man beispielsweise von Westdeutschland zunächst Stationen aus Polen, später Schweden oder Norwegen erreichen kann. Prüfungsfrage:
Prüfungsfrage:
Sporadic-E
Wesentlich größere Reichweiten im VHF-Bereich erreicht man über die Reflexion an der sporadisch auftretenden E-Schicht. In den Sommermonaten Juni und Juli treten gelegentlich so stark ionisierte Bereiche am unteren Rand der E-Schicht auf, dass nicht nur Kurzwellen, sondern auch Ultrakurzwellen reflektiert werden können. Diese vereinzelt auftretenden "Ionisationswolken" heißen "sporadische E-Schicht", Sporadic-E oder kurz E-S. Wodurch diese räumlich begrenzten Schichten entstehen, ist noch nicht geklärt. Es wird angenommen, dass eine ES-Schicht eine Ausdehnung von nur 10 mal 10 km und eine Dicke von 100 m bis 2000 m haben kann. Diese reflektierende Fläche verändert ständig ihre Form und Lage, so dass während der Funkverbindung sehr starke QSB-Phasen auftreten (QSB = Schwankung der Feldstärke). Sehr ausführlich wird der Funkbetrieb über Sporadic-E und auch die anderen Betriebsarten im Buch „Moltrecht, Amateurfunk-Lehrgang – Betriebstechnik (VTH-Verlag) beschrieben. Wahrscheinlich benutzen Sie dieses Buch bereits parallel zum Technik-Lehrgang.
Prüfungsfrage:
Aurora In der Zeit des Sonnenfleckenmaximums bis etwa drei Jahre danach (zuletzt 1999 bis 2003) werden besonders im Frühjahr und im Herbst von der Sonne in großen Massen kleinste Teilchen (Korpuskeln) ausgeschleudert, die vom magnetischen Feld der Erde so abgelenkt werden, dass sie sich in einem Ring um die Erdpole am Polarkreis ansammeln. Die dadurch entstehende zusätzliche Ionisierung, die als Polarlicht sichtbar wird, macht eine Reflexion der Wellen im VHF-Bereich (6-m-Band, 2-m-Band) möglich. Funkverbindungen über diese meist nur sehr kurzzeitig auftretende Erscheinung sind praktisch nur in Telegrafie möglich, denn die Signale werden bei der Reflexion an dieser Schicht so stark verzerrt, dass nur noch ein getastetes Rauschsignal zu vernehmen ist. Sprache ist fast unverständlich. Es klingt, als ob jemand heiser flüstert. Prüfungsfrage:
Prüfungsfrage:
Prüfungsfrage:
Prüfungsfrage:
Weitere UKW-Betriebsarten Wegen der relativ geringen Entfernungen, die man im VHF-/UHF-Bereich normalerweise erreicht, hat man etliche weitere Betriebsarten entwickelt, um die Reichweite zu erhöhen. Dazu gehören das Ausnutzen von Reflexionen an Meteoriten (Meteorscatter), oder an der Mondoberfläche (EME) und der Funkbetrieb über künstliche Umsetzer wie Relaisfunkstationen oder Umsetzer an Ballons (ARTOB). Sehr interessant ist auch der Funkbetrieb über Amateurfunk-Satelliten (OSCAR). Darüber finden Sie mehr unter FUNKTECHNIK auf der Homepage von DJ4UF. © Eckart K. W. Moltrecht, aus dem Buch 411 0064 5.Auflage 2007 nach HTML konvertiert
Anhang Formelsammlung zur Prüfung zum Amateurfunklehrgang Klasse E
Hinweis *) Dies ist eine Lektion aus dem Buch Amateurfunk-Lehrgang für das Amateurfunkzeugnis Klasse E von Eckart K. W. Moltrecht, 5. Auflage 2007.
Letztes Update dieser Seite: 28.3.2007 (by DJ4UF) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||