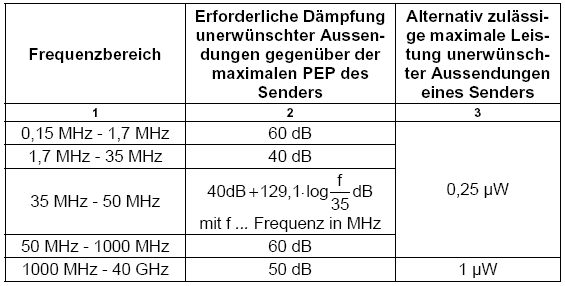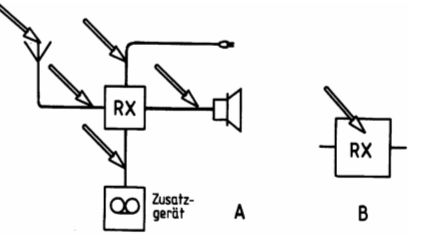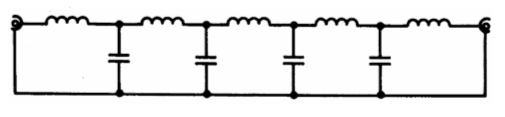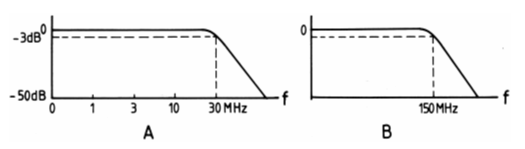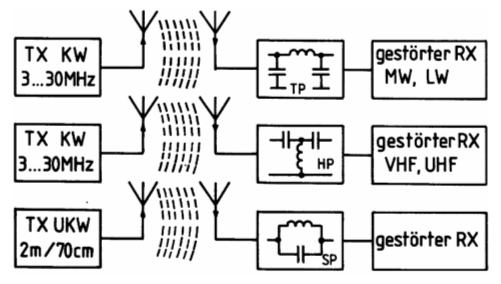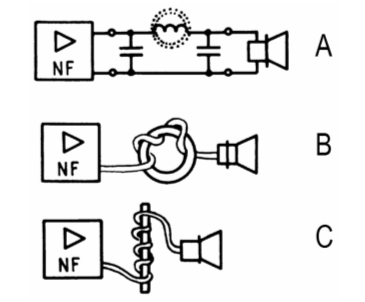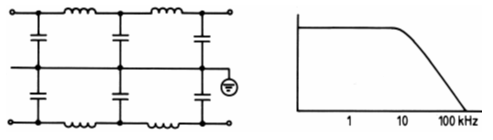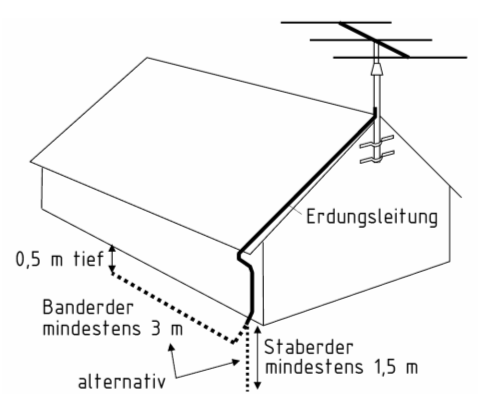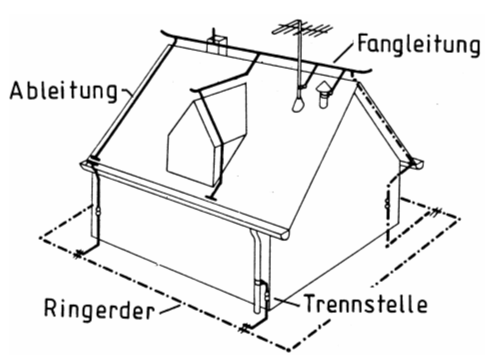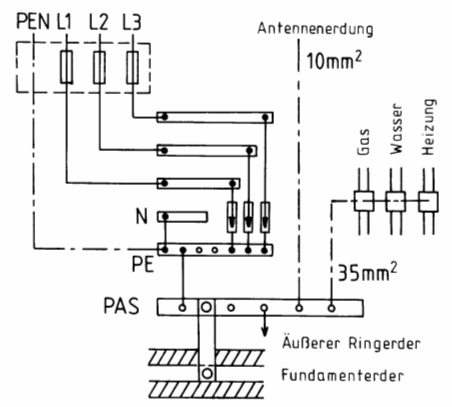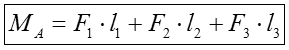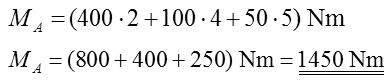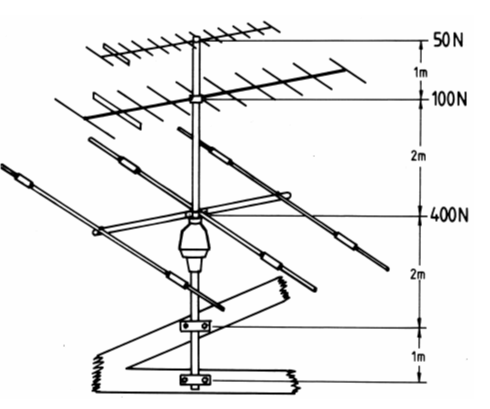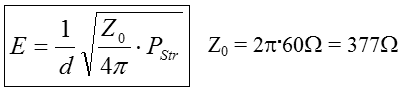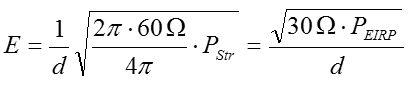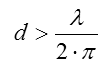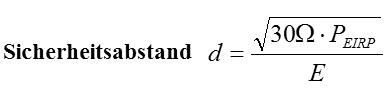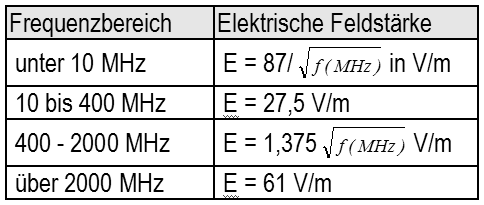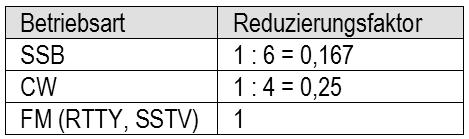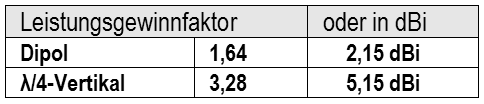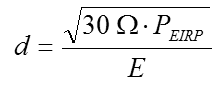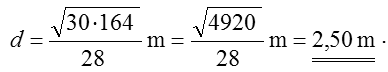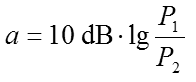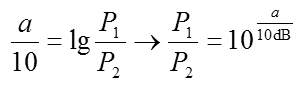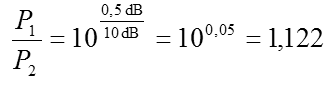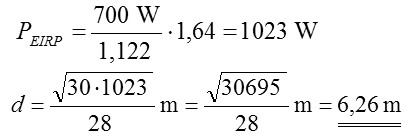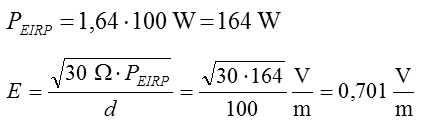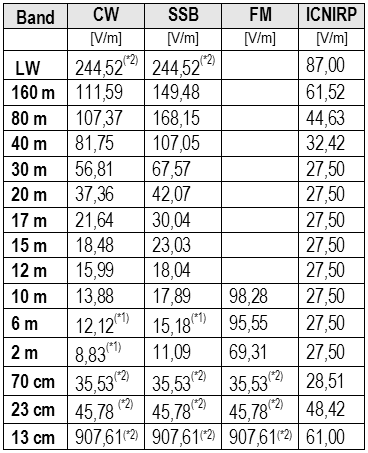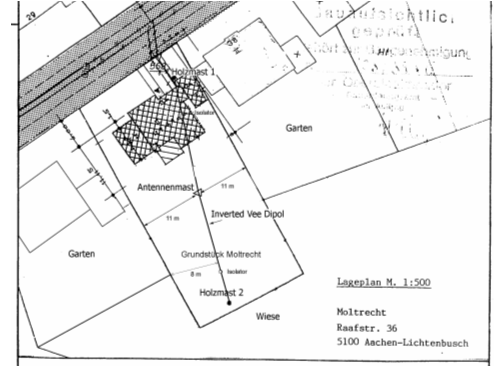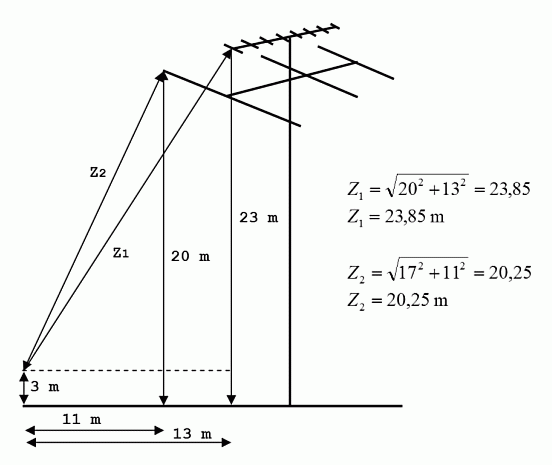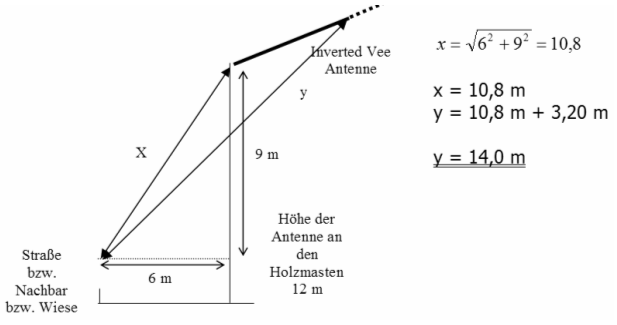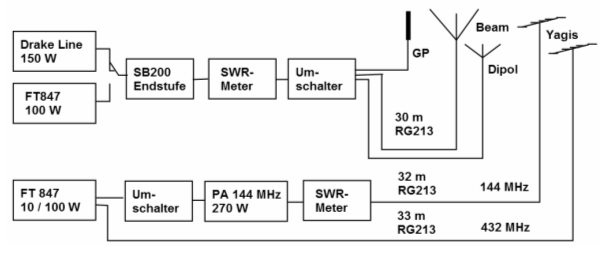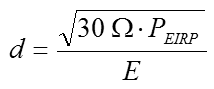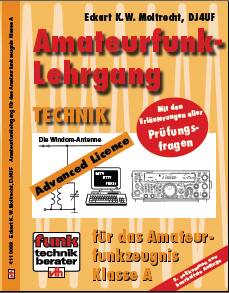|
|
Online zur Amateurfunkprüfung Klasse A von E. Moltrecht, DJ4UF |
Lehrgang nach dem neuen Fragenkatalog vom 28.2.2007 In dieser Lektion wurden größtenteils die Falschantworten weggelassen. Es ist vielleicht besser, sich bei diesem Gebiet nur die richtigen Antworten zu merken. Man kommt sonst sehr leicht in Verwirrung mit den Begriffen.
Als Funkamateur hat man natürlich die Verantwortung für seine Funkgeräte und Antennen, einerseits was störende Beeinflussungen angeht und andererseits, was die Sicherheit von Sachen und Personen angeht.
StörungenStörungen liegen dann vor, wenn unerwünschte Nebenausstrahlungen vom Sender verursacht werden, die eventuell direkt in den Empfangskanal eines anderen Gerätes fallen. Störende Beeinflussungen entstehen, wenn der Sender zwar einwandfrei auf seiner Sollfrequenz arbeitet, aber durch seine Feldstärke den Empfang auf anderen Frequenzen beeinflusst. Unerwünschte Aussendungen des Amateurfunksenders können durch Oberwellen oder Nebenausstrahlungen entstehen. Oberwellen sind Vielfache der Grundfrequenz, die durch Nichtlinearitäten im Sender hervorgerufen werden. Nebenausstrahlungen können mischfrequente Aussendungen sein, die im Zuge der Erzeugung der Sendefrequenz gebildet werden und nicht ausreichend gefiltert werden. Die Nebenausstrahlungen eines Senders dürfen bestimmte vorgeschriebene Grenzen nicht überschreiten. Das eigene Signal darf mit seiner Bandbreite die für den Amateurfunk festgelegten Frequenzbereiche nicht überschreiten. Gemäß § 16 der Verordnung zum Gesetz über den Amateurfunk vom 15. Februar 2005 wurden folgende Richtwerte für unerwünschte Aussendungen von Funkanlagen, die von Funkamateuren im Sinne des Amateurfunkgesetzes verwendet werden, veröffentlicht. In Anlehnung an EU-Normen erfolgt die Messung der Leistungen, die zu unerwünschten Leistungen führen, an den punkten der Amateurfunkanlage, an die Antennen bzw. Anpassgeräte angeschlossen werden. Dabei soll das beim Funkbetrieb verwendete Zubehör (beispielsweise Stehwellenmessgerät) mit einbezogen werden.
Prüfungsfrage TG523 … 0,25 µW überschreitet, sollte sie um mindestens 40 dB gegenüber der maximalen PEP des Senders gedämpft werden.
Prüfungsfrage TG524 … 0,25 µW überschreitet, sollte sie um mindestens 60 dB gegenüber der maximalen PEP des Senders gedämpft werden.
Prüfungsfrage TG525 Richtige Antwort: Die Messung erfolgt am Senderausgang unter Einbeziehung des gegebenenfalls verwendeten Stehwellenmessgeräts und des gegebenenfalls verwendeten Tiefpassfilters.
Prüfungsfrage TG522 … den geltenden Richtwerten entsprechen.
Prüfungsfrage TK204 ... 40 dB betragen.
Prüfungsfrage TK206 Lösung: Bei FM wird die Frequenz durch Modulation symmetrisch nach oben und nach unten beeinflusst. 15 kHz Bandbreite verteilen sich also zu ±7,5 kHz. Man kann also bis 7,5 kHz an die Bandgrenze gehen. Prüfungsfrage TK207 ... Hubeinstellung. Störende BeeinflussungenZu den störenden Beeinflussungen im Senderfrequenzbereich gehören zum Beispiel Intermodulation und Zustopfeffekte. Intermodulation entsteht, wenn zwei oder mehr starke Signale die Mischstufe des Empfängers übersteuern und Phantomsignale erzeugen, die beim Einschalten des Abschwächers im Empfänger verschwinden.
Prüfungsfrage TK101 Richtige Antwort: Durch den Rückgang der Empfindlichkeit und ggf. das Auftreten von Brodelgeräuschen.
Prüfungsfrage TK102 Richtige Antwort: Es treten Phantomsignale auf, die bei Einschalten eines Abschwächers verschwinden. Prüfungsfrage TK108 ... durch Übersteuerung mit dem Signal eines nahen Sender störend beeinflusst.
Einströmungen und Einstrahlungen
Störende Beeinflussungen entstehen dadurch, dass starke Sendersignale in der Nachbarschaft irgendwie in den Verstärkerkanal des Rundfunk- oder Fernsehempfängers gelangen und dann entweder Übersteuerungseffekte auftreten oder Einfluss auf die Regelspannung besteht. Sie lassen sich grundsätzlich nur auf der Empfängerseite beheben, wenn die Senderleistung nicht reduziert werden soll. Die störende Hochfrequenzenergie gelangt entweder durch Einströmung oder durch Einstrahlung in den Empfänger. Einströmungen liegen dann vor, wenn die HF über Leitungen oder Kabel in das gestörte Gerät gelangt. Dies kann über die Antenne und die Antennenzuführung passieren oder auch über Verbindungsleitungen des Gerätes mit anderen Geräten oder den weit abgesetzten Lautsprechern. Bei einer Einstrahlung dagegen gelangt das störende HF-Signal über das ungenügend abgeschirmte Gehäuse direkt in die Elektronik. Die Einströmungen und Einstrahlungen können dazu führen, dass an PN-Übergängen von Transistoren eine Gleichrichtung stattfindet, die dann den Arbeitspunkt verändert und dadurch zu Zustopfeffekten führt oder das NF-Signal im Lautsprecher hörbar wird.
Prüfungsfrage TK105 … an einem Basis-Emitter-Übergang.
Prüfungsaufgabe TK103 Antwort: Durch Gleichrichtung starker HF-Signale in der NF-Endstufe der Anlage. Für die Beseitigung der Störungen muss zunächst am Empfangsgerät geprüft werden, ob es sich um eine Einströmung oder eine Einstrahlung handelt. Denn Störungen durch Einströmungen lassen sich relativ einfach von außen durch Vorschalten von entsprechenden Filtern beseitigen. Einstrahlungen lassen sich nur durch Abschirmung des Gehäuses oder der entsprechenden Baugruppe verhindern. Eine Ableitung an der Stelle der Elektronik, wo die Übersteuerung auftritt, kann Abhilfe sein. Dafür ist aber ein Eingriff in die Elektronik nötig, was man allenfalls an eigenen, nicht aber bei fremden Geräten machen sollte. Ist die Stelle der Einströmung eindeutig lokalisiert, kann man mit dem Zwischenstecken von Entstörfiltern beginnen.
Prüfungsfrage TK104 … er keine unerwünschten Aussendungen hervorruft.
Prüfungsfrage TK117 … Direkteinstrahlung bezeichnet. Beseitigung von Störungen und störenden BeeinflussungenUm die Störwahrscheinlichkeit zu verringern, sollte die benutzte Sendeleistung auf das für eine zufrieden stellende Kommunikation erforderliche Minimum eingestellt werden. Prüfungsfrage TK301 ... auf das für eine zufrieden stellende Kommunikation erforderliche Minimum eingestellt werden.
Oberwellen- und Nebenwellenausstrahlungen von Sendern lassen sich mit einem Tiefpass am Senderausgang beseitigen. Grundsätzlich lassen sich solche Filter leicht selber bauen, aber wenn sie eine hohe Sperrdämpfung haben sollen, ist die Dimensionierung besonders für Tiefpassglieder bei hohen Frequenzen recht kritisch, so dass oft nur spezielle Computerprogramme bei der Berechnung weiter helfen.
Es gibt kommerzielle Tiefpassglieder für Kurzwellensender, die bis 30 MHz keine nennenswerte Dämpfung und oberhalb von 30 MHz eine hohe Dämpfung haben (Bild 19-3). Für Sender im 2-m-Band oder 70-cm-Band gibt es Tiefpassfilter mit entsprechend höheren Grenzfrequenzen. Die obere Grenzfrequenz fg wird bei 3 dB Leistungsabfall angegeben. Prüfungsfragen TK303
Prüfungsfragen TK302 ... Oberwellenfilter.
Prüfungsfragen TK112 Über jeden beliebigen Leitungsanschluss und/oder über die ZF-Stufen.
Mit Tiefpassfiltern lassen sich Oberwellen unterdrücken. Schwieriger wird es, Nebenwellenausstrahlungen zu unterdrücken, deren Frequenzen niedriger als die höchste Nutzfrequenz sind. In diesem Fall kann kein Tiefpass verwendet werden. Sofern es sich um eine feste Störfrequenz handelt, die sich beim Verändern der Senderfrequenz nicht ändert, kann ein Sperrkreis oder ein Saugkreis an geeigneter Stelle im Sender eingesetzt werden. Prüfungsfrage TK109. ... Problemen mit dem Fernsehempfang.
Für das Vorschalten von Filtern muss man unterscheiden, ob die störenden Beeinflussungen oberhalb oder unterhalb der Sendefrequenz auftreten. Treten störende Beeinflussungen auf Kurzwelle bei einem Rundfunkempfänger auf Mittelwelle auf, sollte durch einen Tiefpass vor dem Empfänger dafür gesorgt werden, dass der tiefer liegende Mittelwellenbereich (ca. 0,5 bis 1,6 MHz) ungedämpft durchgelassen wird und der Kurzwellenbereich 3 bis 30 MHz gesperrt wird (Bild 19-4). Treten die Störungen beim Sendebetrieb im 2-Meter- oder 70-cm-Band auf, wird ein Sperrfilter für die Sendefrequenz vor dem Empfänger die beste Wirkung zeigen.
Prüfungsfrage TK310 Antwort: Ein Hochpassfilter vor dem Antennenanschluss und zusätzlich je eine hochpermeable Ferritdrossel vor alle Leitungsanschlüsse der gestörten Geräte.
Prüfungsfragen TK201 ... einem hohen Nebenwellenanteil.
Prüfungsfragen TK202 ... Eigenresonanz der HF-Drosseln hervorgerufen werden.
Prüfungsfragen TK211 ... Hochpassfilters in das Antennenzuführungskabel des Fernsehempfängers lösen.
Hilft dies allein nicht oder kommen die Einströmungen möglicherweise über die Zuleitungen von angeschlossenen elektronischen Geräten (CD-Player, Videorecorder) in den gestörten Verstärker, kann man Entstördrosseln vor die Leitungsanschlüsse setzen oder versuchen, mit Klappkernen aus Ferritmaterial, wie man sie im Computerzubehör finden kann, eine Entstörung zu bewirken. Bei Einströmungen über die Leitungen zu den Lautsprecherboxen werden in jede Zuleitung Tiefpassfilter eingeschleift. Diese Tiefpassfilter sollen den NF-Frequenzbereich bis zirka 100 kHz ungehindert durchlassen, aber HF-Einströmungen verhindern. Eine Skizze über weitere Möglichkeiten zeigt Bild 19-5. Diese Filter bestehen aus Tiefpässen mit Ringkerndrosseln und Kondensatoren (Bild 19-5 A). Oder man zieht die Lautsprecherleitung mehrfach durch einen Ringkern (B) oder wickelt einen Teil der Leitung auf einen Ferritstab (C).
Prüfungsfrage TK215 … geschirmte Lautsprecherleitungen zu verwenden.
Kommen die Einströmungen nicht über die Antennenzuleitung sondern über die Netzzuleitung im gleichen Haus, wo die Funkanlage betrieben wird, sollte zunächst die Netzleitung des Senders über ein Breitbandnetzfilter verdrosselt werden (Bild 19-6). Ein gleiches Filter kann in die Netzleitung des gestörten Empfängers eingeschleift werden. Prüfungsfragen TK312 ... ist ein Netzfilter vorzusehen.
Prüfungsfragen TK313 Hinweis: Suchen Sie den Tiefpass!
Direkteinstrahlungen liegen dann vor, wenn beim Entfernen sämlicher Zuleitungskabel und Einfügung einer Netzverdrosselung noch immer störende Beeinflussungen vorhanden sind. Sie treten besonders bei Amateursendern auf, die mit maximal zulässigen Senderleistungen und Richtantennen mit hohem Gewinn arbeiten. Oder sie treten auf, wenn sich die Sendeantenne räumlich sehr nah an dem Rundfunk- oder Fernsehempfänger befindet. Prüfungsfragen TK120 ... die Antennenleitung vom Fernsehgeräts zu trennen um zu prüfen, ob die Störungen anhalten.
Prüfungsfragen TK114 ... eine außen angebrachte Fernsehantenne zu installieren.
Die Beseitigung von Störungen durch Einstrahlungen sollte vom Funkamateur nicht selbst vorgenommen werden. Man sollte dem gestörten Nachbarn empfehlen, sich an den Funkstörungsmessdienst mit der bundeseinheitlichen Rufnummer der Funkstörungsannahme: 0 180-3232323. Prüfungsfragen TK111 Sie bieten höflich an, die erforderlichen Prüfungen in die Wege zu leiten.
Prüfungsfragen TK118 ... die zuständige Außenstelle der Bundesnetzagentur um Prüfung der Gegebenheiten zu bitten.
Vorbeugende MaßnahmenEine möglichst hoch über den Häusern angebrachte Richtantenne mit geringem vertikalem Öffnungswinkel ist häufig schon eine gute Vorbeugungsmaßnahme. Generell gilt: Die Sendeantenne sollte so weit wie möglich entfernt von Empfangsantennen für Rundfunk und Fernsehen aufgebaut werden.
Prüfungsfrage TK113 Richtige Antwort aus dem Fragenkatalog: Rechtwinklig zur Häuserzeile.
Prüfungsfrage TK216 Antwort: … mit keiner höheren Leistung zu senden, als für eine sichere Kommunikation erforderlich ist.
Prüfungsfrage TK219 Antwort: … einer Übersteuerung eines TV-Empfängers.
Prüfungsfrage TK106 ... möglichst gut geschirmt sein.
Prüfungsfrage
TK107 werden Gleichtakt-HF-Störsignale unterdrückt.
Prüfungsfrage TK110 ... keramische Kondensatoren über die Basis-Emitter-Übergänge der Endstufentransistoren eingebaut werden.
Prüfungsfrage TK115 ... ist unzureichende HF-Erdung.
Prüfungsfrage TK116 ... so weit entfernt wie möglich installiert werden.
Prüfungsfrage TK119 ... Verminderung der Ausgangsleistung.
Prüfungsfrage TK212 ... ein Tiefpassfilter nachgeschaltet werden.
Prüfungsfrage TK213 ... der Leistungsverstärker übersteuert wird.
Prüfungsfrage TK217 ... können HF-Spannungen ins Netz einkoppeln.
Prüfungsfrage TK218 ... der Einbau eines HF-Trenntrafos möglich.
Prüfungsfrage TK220 ... 1,8-MHz-Sender.
Prüfungsfrage TK221 ... kann in Verbindung mit dem Signal naher Sender unerwünschte Mischprodukte erzeugen, die den Fernsehempfang stören.
Prüfungsfrage TK222 ... zur Übersteuerung der Vorstufe des Fernsehers.
Prüfungsfrage TK304 Antwort: Hochpassfilter
Prüfungsfrage TK311 ... höchstens 2 bis 3 dB betragen.
Prüfungsfrage TK314 ... in einem geerdeten Metallgehäuse untergebracht wird.
SicherheitsanforderungenNicht nur die kommerziellen Sender- und Antennenanlagen, auch die Amateurfunkstellen unterliegen gewissen Sicherheitsanforderungen, damit weder Mensch noch Tier noch Sachen durch diese Anlagen gefährdet werden. Zum Schutz von Menschen, Tieren und Sachen werden von nationalen Verbänden aus Fachleuten der Elektrotechnik, in Deutschland vom Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) Sicherheitsbestimmungen zur Verhütung von Unfällen durch elektrischen Strom erlassen. Die wichtigsten Sicherheitsbestimmungen für elektrische Betriebsmittel (zum Beispiel Funkgeräte) mit Netzwechselspannungen bis 1000 V sowie Nenngleichspannungen bis 1500 V sind DIN VDE 0100 (auch DIN 57100).
Prüfungsfragen TL305 Lösung: grüngelb, braun, blau
BerührschutzDirektes Berühren liegt vor, wenn Körperteile Spannung führende Teile berühren. Zum Schutz gegen direktes Berühren müssen Spannung führende Teile vollständig isoliert oder abgedeckt sein. Indirektes Berühren liegt vor, wenn ein sonst spannungsfreier leitfähiger Teil eines Gerätes, der durch Isolationsfehler Spannung annimmt, berührt wird. Solche Isolationsfehler können dadurch auftreten, dass ein unter Spannung stehender Leiter das Gehäuse berührt. In elektrischen Anlagen sind stets Schutzmaßnahmen gegen direktes und indirektes Berühren anzuwenden. Diese hier beschriebenen Normen gelten für Deutschland. Bei unseren europäischen Nachbarn und erst recht in den USA oder Japan gelten andere Normen. Eingeführte Geräte müssen aber den deutschen Normen entsprechen.
Schutzmaßnahmen durch AbschaltungDiese Schutzmaßnahme hat einen Schutzleiter und schaltet nach dem Auftreten eines Fehlers selbständig durch Sicherungen oder FI-Schutzschalter ab. Sie verhindern das Bestehenbleiben einer unzulässig hohen Berührspannung. Als Schutzleiter wird eine grüngelbe Ader beziehungsweise ein grüngelb isolierter Leiter verwendet. Alle leitfähigen Gehäuse oder Teile der Geräte müssen an einen Schutzleiter angeschlossen werden. Merke:
Empfehlenswert für Funkamateure ist eine Fehlerstromschutzeinrichtung (FI). Bei dieser Schutzeinrichtung werden die Spannung führenden (Außen)leiter und der Neutralleiter (N) durch einen Summenstromwandler geführt. Ist die Summe der über die Außenleiter und den N-Leiter fließenden Ströme nicht null, fließt also Strom nach Erde ab, löst bei einer bestimmten Differenz der FI-Schutzschalter aus und unterbricht die gesamte Spannungsversorgung. Es gibt FI-Schutzschalter, die bereits ab 30 mA Differenzstrom auslösen. Bei gleichzeitiger Berührung eines Spannung führenden Leiters und Erde würde ein Strom über den menschlichen Körper nach Erde abfließen und der FI-Schalter auslösen. Wenn Ihr Haus oder die Wohnung nicht FI-geschützt ist, sollten Sie als Funkamateur mindestens den Basteltisch und damit sich selbst durch einen FI-Schalter schützen. Bei gleichzeitiger Berührung zweier Außenleiter oder eines Außenleiters und des Neutralleiters nutzt dieser FI-Schutzschalter allerdings nichts.
Die Erdung von AntennenAlle leitfähigen Teile von Antennenanlagen außerhalb von Gebäuden müssen über eine Erdungsleitung mit dem Erder verbunden werden. Bei Zimmerantennen, bei Antennen, die im Gerät eingebaut sind, bei Antennen unter der Dachhaut und bei so genannten Fensterantennen darf auf eine Erdung verzichtet werden. Fensterantennen sind Antennen, deren höchster Punkt mindestens 2 m unter der Dachkante liegt und deren äußerster Punkt höchstens 1,5 m von der Außenfront des Gebäudes entfernt ist. Erdungsleiter, die eigens für die Antennenanlage gelegt werden, müssen folgende Mindestmaße haben.
Erdungsleitungen innerhalb von Gebäuden dürfen bis zu 1 m aus dem Gebäude herausgeführt werden. Erdungsleitungen sind auf kürzestem Weg und möglichst senkrecht zum Erder zu führen. Sie sollen möglichst sichtbar oder in Kunststoffrohren verlegt werden. In diesen Rohren dürfen aber keine anderen Leitungen liegen.
Prüfungsfrage TL302 Lösung: Siehe Tabelle Erdungsleiter: Als geeigneter Erdungsleiter gilt ein Einzelmassivdraht mit einem Mindestquerschnitt von 16 mm2 Kupfer, isoliert oder blank, oder 25 mm2 Aluminium isoliert oder 50 mm2 Stahl.
Sind Potenzialausgleichsleitungen zwischen Betriebsmitteln, z.B. Verstärkern der Antennenanlage erforderlich, so sind diese Leitungen aus mindestens 4 mm2 Kupferdraht blank oder isoliert zu installieren (Kennzeichnung der isolierten Leitungen: grün/gelb).
Prüfungsfrage TL102 … sollten alle Einrichtungen mit einer guten HF-Erdung versehen werden.
BlitzschutzAntennen erden - genügt das? Jährlich gehen etwa eine Million Wolke-Erde-Blitze in Deutschland nieder. Auch wenn nur ein geringer Teil dieser Blitze direkt in Gebäude einschlägt, so werden doch für das Gebiet Deutschland jährlich mehr als 30000 Schadensfälle durch Blitzschlag mit Sachschäden in Millionenhöhe gemeldet. Die Anzahl der Schäden durch indirekte Blitzwirkung hat in den letzten Jahren durch die zunehmende Ausstattung mit Elektronikgeräten und Computern stark zugenommen. Durch die großen Blitzströme mit sehr steilen Anstiegsflanken können auch durch Induktion hohe Spannungen im Innern von Gebäuden entstehen. Diese Überspannungen entstehen sowohl in offenen als auch in geschlossenen Schleifen und zwar unabhängig davon, ob diese Installationsschleifen leitend mit Blitzableitern verbunden oder davon isoliert sind. Eine offene Induktionsschleife entsteht beim Amateurfunk häufig dadurch, dass der Funkamateur bei aufkommendem Gewitter den Antennenstecker abzieht und diesen offen liegen lässt, anstatt das Kabel zu erden. Zwischen dem Koaxkabel und dem Gehäuse des Funkgerätes entsteht eine hohe Induktionsspannung, die zu einem Überschlag führen kann.
Bei Gewitterneigung und wenn Sie die Wohnung für längere Zeit verlassen, ziehen Sie die Netzstecker der Funkgeräte und erden Sie Ihre Antennenleitungen. Wenn Sie Hauseigentümer sind und eine Antennenanlage auf Ihrem Haus aufgebaut haben, sollten Sie sich vom Fachmann einen Blitzschutz installieren lassen. Außer dem äußeren Blitzschutz, wie er im Bild 19-10 dargestellt ist, kommt noch der innere Blitzschutz nach Bild 19-11 hinzu, wobei alle Hausanschlussleitungen durch eine Überspannungsschutzeinrichtung gegen Blitzströme von außen geschützt werden. Das Standrohr einer Amateurfunkantenne auf einem Gebäude darf mit einer vorhandenen Blitzschutzanlage verbunden werden, wenn die vorhandene Blitzschutzanlage fachgerecht aufgebaut ist und das Standrohr mit ihr auf dem kürzesten Wege verbunden werden kann. Mehr dazu unter www.vde.com/blitzschutzfunksysteme
Prüfungsfrage TL301 Wenn die vorhandene Blitzschutzanlage fachgerecht aufgebaut ist und das Standrohr mit ihr auf einem sehr kurzen Weg verbunden werden kann.
Prüfungsfrage TL303 Jeder ordnungsgemäß verlegte Fundamenterder kann verwendet werden, sofern alle Blitzschutzleitungen bis zur Potentialausgleichsschiene getrennt geführt werden.
Prüfungsfrage TL304 Die Außenleiter (Abschirmung) aller Koaxialkabel-Niederführungen müssen über einen Potentialausgleichsleiter normgerecht mit Erde verbunden werden.
Mechanische Sicherheit der AntennenanlageDie gesamte Antennenanlage muss den auftretenden mechanischen Beanspruchungen und Witterungseinflüssen standhalten. Die Antennen und die Rohrverbindungen am Standrohr müssen gegen unerwünschtes Verdrehen gesichert sein. Gewindemuffen als Rohrverbindung sind unzulässig. Als Standrohre für Antennen gibt es Rohre aus einem Stück, Steckrohre und Schieberohre. Diese Rohre bestehen meist aus Stahl- oder bestimmten Aluminiumlegierungen und haben gewährleistete Mindestwerte der Festigkeit. Gasrohre und Wasserrohre erfüllen die Festigkeitsbedingungen nicht und sind deshalb nicht zulässig. Die Standrohre aus Stahl müssen im Einspannbereich eine Mindestwanddicke von 2 mm haben. Sie müssen verzinkt oder gleichwertig gegen Korrosion geschützt sein. Auf Antennen wirken bei Wind erhebliche Kräfte, die man als Windlast FA bezeichnet. Die Einheit der Windlast wird in Newton (N) angegeben. Diese Windlast entsteht durch den Stau der bewegten Luft an Teilen der Antenne (Staudruck). p ist der Staudruck (Winddruck) in N/m2 und A ist die wirksame Antennenfläche in m2, auf die der Wind auftreffen kann. Für Antennen mit Standrohren bis zu einer freien Rohrlänge von 6 m und bis zu einem Einspannmoment von 1650 Nm (Newton-Meter) auf Bauwerken bis zu acht Geschossen (etwa 20 m über der Geländeoberfläche) darf für p = 800 N/m2 eingesetzt werden.
Aufgabe Die Antenne ruft infolge der Windlast auf das Standrohr ein Drehmoment hervor, das man Biegemoment nennt. Das Biegemoment MA in Nm berechnet sich aus dem Produkt Windlast mal Länge vom Einspannpunkt bis zur Antenne. Sollen mehrere Antennen an einem Mast montiert werden, sind die Biegemomente zu addieren.
Beispiel Lösung: Für dieses Biegemoment von 1450 Nm muss der Mast geeignet sein.
Tragende Bauteile, zum Beispiel Gebäudeteile wie Dachbalken, die zur Befestigung von Antennen, Antennenstandrohren und Abspannseilen dienen, müssen ebenfalls eine ausreichende mechanische Festigkeit besitzen. Die Befestigung des Standrohres am Schornstein ist verboten. Die Verbindungsmittel mit dem tragenden Bauteil müssen die auftretenden Kräfte dauerhaft übertragen. Diese Kraftübertragung darf durch Alterung und Korrosion nicht beeinträchtigt werden. Gips und Dübel aus thermoplastischem Kunststoff erfüllen diese Forderung im Allgemeinen nicht. Jede Halterung des Standrohres muss mit mindestens zwei Schrauben am tragenden Bauteil befestigt werden. Bei Befestigung am Gebälk sind Schlüsselschrauben von mindestens 8 mm Durchmesser erforderlich, bei Befestigung im Mauerwerk mindestens Schrauben M8. Abspannseile sollen größere Schwankungen durch den Wind verhindern. Die Antennenanlage muss die Forderungen an die mechanische Festigkeit auch ohne Abspannseile erfüllen. Die Abspannseile dürfen bei der Ermittlung der mechanischen Festigkeit also nicht berücksichtigt werden. Die Verbindungsmittel sollen aus geeigneten Werkstoffen bestehen, damit Korrosion durch Elementbildung möglichst verhindert wird. Die Antennenanlage ist so aufzustellen, dass abknickende Bauteile der Antennen darunter liegende Starkstromleitungen nicht berühren können. Das Abknicken des Standrohres wird nicht angenommen. Der waagerechte Abstand des Standrohres zur Starkstromfreileitung und der Abstand zwischen Antennenteilen und der Starkstromfreileitung muss mindestens 1 m betragen.
Sendeanlage im KFZDamit die Zulassung eines Kraftfahrzeugs nicht ungültig wird, sollten Sie vor dem Einbau einer mobilen Sendeanlage die Anweisungen des Kraftfahrzeugherstellers beachten. Manche Hersteller erlauben nur den eingeschränkten Einsatz einer Amateurfunkanlage bis zu einer bestimmten Sendeleistung. Um ein Einwirken der Hochfrequenz in die Elektronik des Kraftfahrzeugs zu verhindern, sollten Antennen und Antennenkabel möglichst weit davon entfernt verlegt werden. Die beste Abstrahlung hat eine mobile VHF-Antenne, wenn sie in der Mitte des Wagendaches installiert wird.
Prüfungsfragen TL306 ... die Anweisungen des Kfz-Herstellers zu beachten.
Prüfungsfragen TL307 ... möglichst weit von der Fahrzeugverkabelung entfernt verlegt werden.
Mehr dazu auf der KFZ-Info-Seite des DARC unter www.darc.de/referate/emv/.
Zur Vorlage bei einer Kontrolle:
PersonenschutzUm Schädigungen durch zu hohe Feldstärken bei Menschen zu vermeiden, muss verhindert werden, dass ein Mensch so nahe an die Antennenanlage kommen kann, dass eine zu hohe Feldstärke auf seinen Körper einwirkt. Für die Feldstärkeberechnung nach der Personenschutznorm (EMVU = Elektromagnetische Verträglichkeit Umwelt) gelten zwei verschiedene Aufenthaltsbereiche, nämlich einmal der Expositionsbereich 1 für vom Betreiber der Anlage kontrollierte Bereiche, z.B. das Haus des Funkamateurs und der Expositionsbereich 2, das sind die für den normalen Bürger jederzeit zugänglichen Bereiche, mit Aufenthalt dort mehr als sechs Stunden pro Tag. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat Rechenregeln aufgestellt (Entwurf DIN VDE 0848), nach denen man die Grenzwerte der elektrischen Ersatzfeldstärke berechnen kann. Es soll nun eine vereinfachte Formel abgeleitet werden, die einen Zusammenhang zwischen der elektrischen Feldstärke und dem Abstand herstellt. Daraus kann dann der Sicherheitsabstand ermittelt werden, wenn die maximal zulässige Feldstärke bekannt ist. Diese Grenzwerte werden „gesetzlich“ vorgegeben. Wie bereits in der Lektion 8 im Abschnitt über die elektrische Feldstärke ausgeführt wurde, kann man näherungsweise die Feldstärke aus der isotropen Strahlungsleistung Pstr und dem Abstand r berechnen. Setzt man die Größe für den Feldwellenwiderstand als Wert in die Formel ein, kann man sie noch weiter vereinfachen. Zur Erinnerung: Diese Formel gilt nur für das Fernfeld. Das Fernfeld gilt ab bei Dipolantennen wie Drahtdipole, Yagi-Antennen und so weiter. Für andere Antennenarten wie Parabolspiegel oder magnetische Antennen muss der Sicherheitsabstand durch andere Methoden ermittelt werden. Dies können Messungen, Simulationsrechnungen, Nahfeldberechnungen oder andere Verfahren sein, die die Situation im Nahfeld berücksichtigen. Prüfungsfrage TL213 Antwort aus dem Fragenkatalog: Die Formel gilt nur für Abstände d > λ/2π bei Dipol-Antennen (Drahtdipole, Yagi-Antennen etc.). Für andere Antennenarten und in kürzerem Abstand zur Antenne muss der Sicherheitsabstand durch andere Methoden ermittelt werden. Dies können Messungen, Simulationsrechnungen, Nahfeldberechnungen oder Verfahren sein, die die Situation im reaktiven Nahfeld berücksichtigen.
Wird diese vereinfachte Formel nach d umgestellt, erhalten wir die Formel zur berechnung des Sicherheitsabstands für personenschutz, die auch in der Formelsammlung zur Prüfung der BNetzA zu finden ist.
Diese Formel besagt: Wenn man die zulässigen Grenzwerte für die elektrische Feldstärke E für Personenschutz (Siehe folgende Tabelle) und die verwendete Strahlungsleistung der Antenne PEIRP kennt, kann man daraus den Sicherheitsabstand in Meter berechnen, der eingehalten werden muss, um auf keinen Fall Personen mit der Hochfrequenz-Strahlungsleistung zu gefährden. Grenzwerte für Personenschutz
Die in der Tabelle angegebenen Maximalwerte der Feldstärken gelten als Effektivwerte, gemittelt über 6-Minuten-Intervalle. Im Amateurfunk ist der Mittelwert erheblich geringer als die zulässigen Spitzenwerte von 75 Watt. Bei SSB ist der Mittelwert je nach Klippgrad etwa 1 : 6 bis 1 : 4. Bei Morsetelegrafie ist durch die Pausen zwischen den einzelnen Zeichen der Mittelwert etwa 1 : 4. Nur bei Frequenzmodulation und auch bei Frequenzumtastung (z.B. RTTY) ist der Mittelwert gleich der Trägerleistung. Um den Mindestabstand berechnen zu können, muss man die Strahlungsleistung EIRP kennen. Die Formel zur Feldstärkeberechnung geht von einem Kugelstrahler aus, den es in der Praxis nicht gibt. Für die verschiedenen Antennenformen muss der Leistungsgewinnfaktor bekannt sein, um die Strahlungsleistung berechnen zu können. Für einen Dipol gilt ein Gewinnfaktor von 1,64 (2,15 dB) und für einen Lambdaviertelstrahler (z.B. GP) ein Faktor von 2 · 1,64 = 3,28 (5,15 dB). Bei Richtantennen nimmt man den Gewinn aus dem Richtdiagramm.
Prüfungsaufgabe TL206 Lösung: Für einen Dipol gilt ein Gewinnfaktor von 1,64. Das ergibt eine maximale Strahlungsleistung PEIRP von 164 W. Die Formel lautet. Eingesetzt ergibt sich Es muss also von jedem Punkt der Antenne ein Abstand von mindestens 2,50 m eingehalten werden.
Prüfungsfrage TL203 Lösung: Es wird eine Kabeldämpfung von 0,5 dB vorgegeben. Für 0,5 dB gibt es in der Formelsammlung keinen Umrechnungsfaktor. Er soll hier berechnet werden. In der Formelsammlung findet man Diese Formel soll nach P1/P2 umgestellt werden. Eingesetzt ergibt sich Die gegebene Leistung von 700 W muss also durch diesen Faktor geteilt werden und mit dem Gewinnfaktor eines Dipols multipliziert werden. Als Lösung wird 6,3 m vorgegeben.
Prüfungsfragen TL204 Lösung: 7,1 m
Prüfungsfragen
TL205 Lösung: 4,1 m
Prüfungsfragen TL207 Lösung: 5,01 m
Prüfungsfragen TL208 Lösung: 6,86 m
Prüfungsaufgabe TL202 Lösung: In diesem Fall muss die Formel für den Sicherheitsabstand nach E umgestellt werden. Die Umrechnung von ERP nach EIRP verlangt die Berücksichtigung des Gewinnfaktors von 1,64 oder 2,15 dB. Als Lösung wird 0,7 V/m vorgegeben. Prüfungsfragen TL209 Lösung: Weil die elektrische und die magnetische Feldstärke im Nahfeld keine konstante Phasenbeziehung zueinander aufweisen.
Prüfungsfragen TL211 Lösung: Sie addieren die Verluste zwischen Senderausgang und Antenneneingang und berechnen aus dieser Dämpfung einen Dämpfungsfaktor D; die Antenneneingangsleistung ist dann Pant = D·PSender.
Prüfungsfragen TL214 Lösung: Mit dem Mittelwert der Ausgangsleistung gemittelt über ein Intervall von 6 Minuten.
Prüfungsfrage TL212 Zur Lösung: Man nennt dieses Prinzip Berücksichtigung der Winkeldämpfung. Wenn von einer Richtantenne das vertikale Strahlungsdiagramm bekannt ist, kann man daraus ablesen, wie viel weniger die Antenne nach schräg unten strahlt. In dieser Aufgabe wird in der entsprechenden Richtung eine Winkeldämpfung von 6 dB angegeben. 6 dB ist ein Viertel der Leistung. Da die Leistung in der Formel unter der Wuzel steht, ergibt sich der halbe Wert für den Sicherheitsabstand. Aus 20 m werden 10 m. Man kann also näher an die strahlende Antenne heran gehen.
PlausibilitätserklärungJede Sendestation - ob Amateurfunk oder kommerziell - muss nachweisen, dass niemand in einem starken elektrischen Feld einer Sendeantenne zu Schaden kommen kann. Diesen Nachweis müssen kommerzielle Stationen mit einer Feldstärkemessung nachweisen. Funkamateure dürfen anstatt einer Messung auch durch eine überschlägige Berechnung plausibel machen, dass sie die festgelegte Maximalfeldstärke in Bereichen, die für Fremde zugänglich sind, nicht überschreiten. Diesen Nachweis nennt man Plausibilitätserklärung oder Selbsterklärung. Im Frequenzbereich von 3 kHz bis 300 GHz werden die Grenzwerte für den Personenschutz in der DIN VDE 0848 festgelegt. Zusätzlich werden im Frequenzbereich von 50 kHz bis 50 MHz Beeinflussungsschwellen für Herzschrittmacher geltend gemacht. Die Einhaltung dieser Grenzwerte ist durch den Funkamateur nachzuweisen. Jeder Funkamateur, der eine höhere Sendeleistung als 10 W EIRP verwendet, muss eine solche Selbsterklärung der zuständigen Außenstelle der Bundesnetzagentur zuschicken. Wie eine solche Selbsterklärung verfasst wird, soll hier erläutert werden. Zur Erstellung dieser Selbsterklärung können Sie ein Berechnungsprogramm verwenden. Empfohlen wird das Programm WATT32, das auch von der Bundesnetzagentur anerkannt wird. Wenn Sie mit den Berechnungen Probleme haben, wenden Sie sich an ihren Ortsverband (OV) des DARC. Es gibt in fast jedem OV einen EMV-Beauftragten, der sich mit den Berechnungen und der Erstellung der Selbsterklärung auskennt. Er hat dieses Berechnungsprogramm zur Verfügung.
(*1) Bei diesem Wert handelt es sich um eine Inter- oder Extrapolation der Nachbarwerte (*2) Für diesen Wert liegt für die entsprechende Betriebsart kein Grenzwert in der Norm vor. Gemäß der Norm, wird als Grenzwert dann derjenige für die nächst störendere Betriebsart gewählt. Die Werte in der Tabelle 19-2 stammen von der Verbandsbetreuung des DARC (Deutscher Amateur Radio-Clubs e.V.) vom 12.1.2007. Die hier in Tabellenform aufgelisteten HSM-Grenzwerte sind Effektivwerte. Sie wurden jeweils berechnet für die Frequenz innerhalb eines Amateurfunkbandes, für die der geringste Wert angenommen wird, so dass sie für die gesamte Frequenzspanne verwendet werden können. Sie gelten oberhalb 16,9 MHz immer, darunter unter Fernfeldbedingungen. Werden sie in diesem Frequenzbereich jedoch im Nahfeld verwendet, stellen sie höhere Anforderungen, als eigentlich notwendig wäre. Daher ist man grundsätzlich auf der sicheren Seite. In der letzten Spalte sind zusätzlich auch noch die Grenzwerte für den Personenschutz nach ICNIRP angegeben. Es gibt zwei Prinzipien, die Selbsterklärung auszuführen. Die einfachste ist, mit den vorhandenen Geräten und Antennen die Sicherheitsabstände auszurechnen und diese in den Lageplan (Bild 19-13) einzutragen. Sollten damit die Grenzen des kontrollierbaren Bereichs (das eigene Grundstück) überschritten werden, können Sie auch aus den sich ergebenden Abständen zum nicht kontrollierbaren Bereich die maximal zu verwendende Senderleistung berechnen. Im Prinzip muss man für jedes Amateurfunkband und jede Station/Antenne, die man verwendet, eine Berechnung durchführen, wie groß bei einer bestimmten Senderleistung der Abstand sein muss oder welche Leistung man benutzen darf, wenn ein bestimmter Abstand vorgegeben ist. Dazu muss ein Plan des Grundstücks mit Lage der Antennen (Bild 19-13) und eine Skizze der Seitenansicht (Bild 19-14) mitgesendet werden, aus denen für die Behörde ersichtlich ist, wie groß die Abstände zu Nachbargrundstücken oder öffentlichen Wegen ist. Für die Berechnung der Entfernung gilt jeder Punkt der Antenne zum Nachbargrundstück dort in 3 m Höhe. Bei Groundplane-Antennen zählen die Radials als Teil der Antenne. Vom Ende des längsten Radials muss gemessen werden.
Für die Berechnung der Entfernung gilt jeder Punkt der Antenne zum Nachbargrundstück, dort in 3 m Höhe. Bei Groundplane-Antennen zählen die Radials als Teil der Antenne. Vom Ende des längsten Radials muss gemessen werden.
Ferner muss ein Blockschaltbild der Station vorhanden sein, aus dem ersichtlich ist, wie die Sender mit Schaltern und Kabeln mit der Antenne verbunden sind. Mit Hilfe dieses Blockschaltbildes ermitteln Sie die Strahlungsleistung EIRP durch Berücksichtigung der Verluste durch Umschalter und Kabel. Nun können Sie die eigentliche Berechnung durchführen. Dazu verwenden Sie wiederum die folgende Formel. Setzen Sie nun für jedes Band und jede Antennenkonfiguration die Werte in die Formel ein und berechnen Sie den Sicherheitsabstand. Ist dieser Wert kleiner als die Entfernung zum öffentlichen Weg oder zum Nachbargrundstück, tragen Sie den Wert in eine Tabelle ein. Ist der berechnete aber größer, müssen Sie Ihre Senderleistung reduzieren. Welche maximale senderleistung Sie benutzen dürfen, finden Sie heraus, indem Sie die Formel nach PEIRP umstellen und die entsprechende Entfernung von der Antenne zum öffentlichen Weg einsetzen.
Prüfungsaufgabe TL201 Lösung: In der Formelsammlung der BNetzA und auch hier im Text zwei Seiten zuvor finden Sie die Angabe, dass ein λ/4-Vertikalstrahler einen Gewinnfaktor von 3,28 besitzt. Faktor bedeutet, dass die verwendete Senderleistung damit multipliziert die Strahlungsleistung EIRP ergibt. Umgekehrt bedeutet dies für die Aufgabe, dass die 10 Watt EIRP durch 3,28 geteilt werden müssen. Dies ergibt 3,05 Watt. Also darf die verwendete Senderleistung (eigentlich Antenneneingangsleistung) zirka 3 Watt nicht überschreiten. Lösung A!
Prüfungsfragen TL215 Lösung: ca. 100 Watt
Prüfungsfragen TL216 Lösung: Ja, er ist in diesem Fall verpflichtet, die Einhaltung der Personenschutzgrenzwerte nachzuweisen. Kommentar: Dies lässt sich ohne große Rechnung sagen, denn 10 dB sind schon das Zehnfache ...
Prüfungsfragen TL217 Lösung: Der maximale Augenblickswert der Feldstärke des modulierten Trägers.
Prüfungsfragen TL218 Lösung: Nein, die Feldstärke beeinflusst unmittelbar, also zeitunabhängig.
BegleitbuchDieser Online-Lehrgang wurde mit freundlicher Genehmigung des Autors aus seinem Buch für das Internet umgewandelt.
Dieser Lehrgang basiert auf dem Prüfungsfragenkatalog 2007 der Bundesnetzagentur (BNetzA). Alle darin vorkommenden Themen wie Grundlagen der Elektrotechnik, Elektronik sowie Sender- und Empfängertechnik, Übertragungstechnik, Antennentechnik und Messtechnik aus dem Gebiet "Technische Kenntnisse" werden ausführlich erläutert. Die Erfahrung mit praktischen Lehrgängen wird genutzt, um den Prüfling in die Lage zu versetzen, jede Frage aus dem Fragenkatalog richtig zu beantworten. Dieses Buch ist auch sehr gut für das Selbststudium geeignet. Dieser Lehrgang baut auf dem Lehrgang für die Klasse E auf. Sie sollten also erst den Lehrgang für das Amateurfunkzeugnis Klasse E durchgearbeitet haben oder zumindest bei Verweisen dort nachlesen können.
*) Wenn Sie noch vor dem 1. Juni die Prüfung Klasse A (nach dem alten
Fragenkatalog Klasse 1+2) machen wollen, sollten Sie sich dieses Buch besorgen,
denn es wird in Kürze ausverkauft sein. Bis Ende Mai wird noch nach dem alten
Fragenkatalog geprüft.
|
||||||||||||||||||